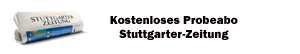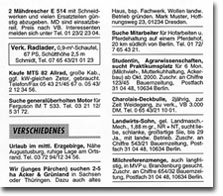Fünf seltene Zicklein
Nach dem Babyboom bei Zwergziegen und Co. im Streichelzoo haben nun die wilden Stammeltern aller Hausziegenrassen, die Bezoarziegen, nachgelegt – vier von sechs Geißen schenkten Ende Mai fünf Zicklein das Leben.

Echte Raritäten: Denn Wildziegen wie sie gibt es nur noch in wenigen Regionen Vorderasiens und als kleine Restbestände auf Kreta, von denen auch die Wilhelma-Tiere abstammen. Zudem ist diese Art in weniger als zehn europäischen Zoos zu sehen.
„Der Ziegen unendliche Menge durchstreift sie, wilden Geschlechts, weil nimmer ein Pfad der Menschen sie scheuchet“. Schon der griechische Dichter Homer erwähnte die Bezoarziegen – hier in den Worten des Odysseus beim Besuch der Kyklopeninsel. Diese heißt heute Gioúra und beansprucht für sich, die letzten wirklich reinrassigen Bezoarziegen zu beherbergen. „Gescheuchet“ wurden diese von den Menschen aber durchaus und seit jeher: Entweder sie wurden gefangen und als Nutztiere domestiziert – was erstmals bereits vor rund 10.000 Jahren geschah – oder wegen ihres Fells, Fleisches und ihrer prachtvollen Hörner gejagt. Zur ernsten Gefahr für die gesamte Art wurde dies erstmals, als im Mittelalter ihre Magensteine oder „Bezoare“, denen diese Wildziege ihren Namen verdankt, als mutmaßliche Wunderheilmittel in Mode kamen. Dabei sind Bezoare nichts anderes als unverdauliche Ballen aus verfilzten, abgeschleckten Haaren, die im Magen mit der Zeit steinhart werden. Der Aberglaube an die Heilkraft solcher tierischer Bestandteile – ob Horn, Zähne oder Bezoare – bedroht bis heute die Existenz vieler Tierarten und strapazierte auch den Bestand der Bezoarziegen: Sie stehen auf der Liste der gefährdeten Arten, nur wenige hundert Tiere gibt es schätzungsweise noch, darunter auf Kreta, in der Türkei, in Pakistan, im Iran und Kaukasus.
Dabei sind die bergtüchtigen Paarhufer für das Leben in ihrer Heimat – felsige, bewaldete Gebirgszüge bis 4200 Meter Höhe – perfekt gerüstet. Absolut trittsicher nutzen sie noch den kleinsten Felsvorsprung und in puncto Speiseplan begnügen sie sich mit Gräsern, Kräutern, Sträuchern, Jungbäumen und Trieben. Ihren Nährstoffbedarf runden die Vegetarier mit gelegentlichen Visiten an „Salzlecken“ ab, das sind lehmig-kalkige, an Natrium und Kalzium reiche Stellen. Die mächtigen Hörner der bis zu 70 Kilo schweren Männchen erinnern an ihre Verwandten, die Steinböcke, und bei Rivalenkämpfen lassen sie es wie diese ordentlich „krachen“. Schließlich kommen bei den halb so schweren Weibchen während der Paarungszeit nur die stärksten Böcke zum Zuge, ansonsten streifen Männer- und Mutter-Kindgruppen von bis zu 25 Tieren meist getrennt durchs Gebirge. Im Mai kommen die Jungen zur Welt. Drei Tage liegen sie in versteckten Felsnischen ab, dann folgen sie den Müttern über Stock und Stein. Rund sechs Monate werden sie gesäugt, bis zu zwölf Monate bleiben sie bei den Müttern. So auch die fünf jüngsten Bezoarzicklein, die sich derzeit zusammen mit sechs Geißen und drei Böcken auf dem Schaubauernhof tummeln. Später werden sie in anderen Zoos zum Arterhalt beitragen, denn außerhalb geschützter Reservate schrumpfen die Bestände weiter: wegen des Holzeinschlags und der mittlerweile riesigen Konkurrenz durch ihre eigenen Nachfahren, die Hausziegen.
Artikel lesen
Nordstream 2 – Was denn nun ?

Wer steckt denn den Vorteil ein. Klar kosten diese Pipeline ein Vermögen, aber die Kosten sind schneller drin als der Winter kommen wird. Bleib also der Betreiber, also die Russen. Egal welche Firmen nun dazwischen stehen, wird es wohl Putin und sein.....
mehr Infos
Kommentare :
Kommentieren Sie diesen Artikel ...
Werbung
Tageszeitungen zum Probe lesenLesen Sie Ihre regionale oder überregionale Tageszeitung völlig gratis zur Probe.