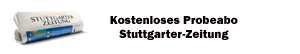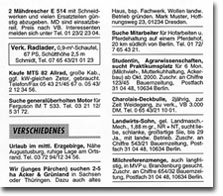Mehr Innovation für mehr Wachstum in Europa
Mehr als 30.000 Euro kostet eine Patentanmeldung für die gesamte Europäische Union, über 80-seitige Anträge für eine EU-Forschungsförderung sind keine Seltenheit.

Hohe Bürokratiekosten, komplexe Strukturen und der Forscher- und Fachkräftemangel hemmen die Innovationsleistung der Unternehmen in Europa. Um diese Hindernisse zu verringern, hat die Europäische Kommission am 6. Oktober eine Initiative mit dem ehrgeizigen Namen „Innovationsunion“ gestartet. Denn: Die EU muss zukünftig ihr Innovationspotenzial besser nutzen, nicht zuletzt, um mit starken Innovationsländern wie den USA oder Japan und aufstrebenden Volkswirtschaften wie China mitzuhalten.
Europäische Innovationsbremsen lösen!
Neben Gütern und Dienstleistungen soll sich auch „Wissen“ in der EU frei bewegen können, damit aus den Investitionen in Forschung und Entwicklung – nach wie vor werden EU-weit 3 % des BIP angestrebt – auch Innovationen und neue Produkte entstehen. Mit der „Innovationsunion“ schlägt die Europäische Kommission eine richtige Richtung ein.
Der DIHK weist auf einige wichtige Punkte hin:
Mehr Forscher und Fachkräfte
Anzahl und Mobilität von Forschern und Fachkräften müssen erhöht werden. In Deutschland fehlen im Jahr eins nach der Wirtschaftskrise bereits 400.000 Fachkräfte, EU-weit wird bis 2020 eine Lücke von fast einer Million Forschern erwartet. Exzellente europäische Forschungsinfrastrukturen und mehr Freiheit bei der Wahl des Aufenthalts- und Niederlassungsorts sind notwendig, um vorhandene Potenziale besser auszuschöpfen. Dazu gehört u. a. die leichtere Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen.
Einheitliches und kostengünstigeres Gemeinschaftspatent nötig
Die Anmeldung eines Patents wird derzeit mit jedem weiteren EU-Land, in dem man einen Antrag stellt, v. a. aufgrund der Übersetzungskosten teurer. Ein einheitliches Patentsystem könnte die Kosten einer EU-weiten Anmeldung um drei Viertel senken. Davon würde die deutsche Wirtschaft als größte Patentanmelderin in der EU profitieren.
EU-Förderprogramme: Deutschland kann Vorbild sein
29 % der Mittel aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm gingen in den letzten drei Jahren an den Privatsektor, davon die Hälfte an KMU. Die EU-Förderprogramme müssen durch einfachere Verfahren und geringere Berichtspflichten für Unternehmen attraktiver werden. Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sollte als Vorbild für eine Straffung und Bündelung dienen. Dort wurden die bestehenden Maßnahmen des BMWi für die technologieoffene Förderung von KMU in einem Programm zusammengeführt und einfache, einheitliche Antragsverfahren eingeführt.
Öffentliches Beschaffungswesen nicht instrumentalisieren
Das Volumen der öffentlichen Aufträge entspricht 17 % des EU-Bruttoinlandsprodukts. Die Kommission will die Vergabe im öffentlichen Auftragswesen stärker an innovativen Kriterien orientieren. Aus Sicht der Wirtschaft kann das zwar zur Verbreitung von Innovationen beitragen, der Innovationswert ist aber oft schwer einzuschätzen und darf deshalb nicht zu einem Hauptentscheidungskriterium erhoben werden. Das würde den Wettbewerb einschränken und die Transparenz des Vergabeverfahrens reduzieren. Beides ginge zulasten der Unternehmen.
Die „Innovationsunion“ ist eine langfristige politische Vision, die es nun mit entsprechenden Verfahren im Europäischen Rat und im Parlament zu realisieren gilt. Sie wird nur Erfolg haben, wenn sie mit den Mitgliedstaaten und den Regionen gemeinsam umgesetzt wird.
Artikel lesen
Spielplatzbetreiber haften

Ende 2019 haben sich die Anforderungen an Karussells und Wippgeräte verändert.
Aber auch andere Teile der bisherigen Spielplatznormen wurden überarbeitet. So wurden beispielsweise neu Bode.....
mehr Infos
Kommentare :
Lesen Sie Ihre regionale oder überregionale Tageszeitung völlig gratis zur Probe.